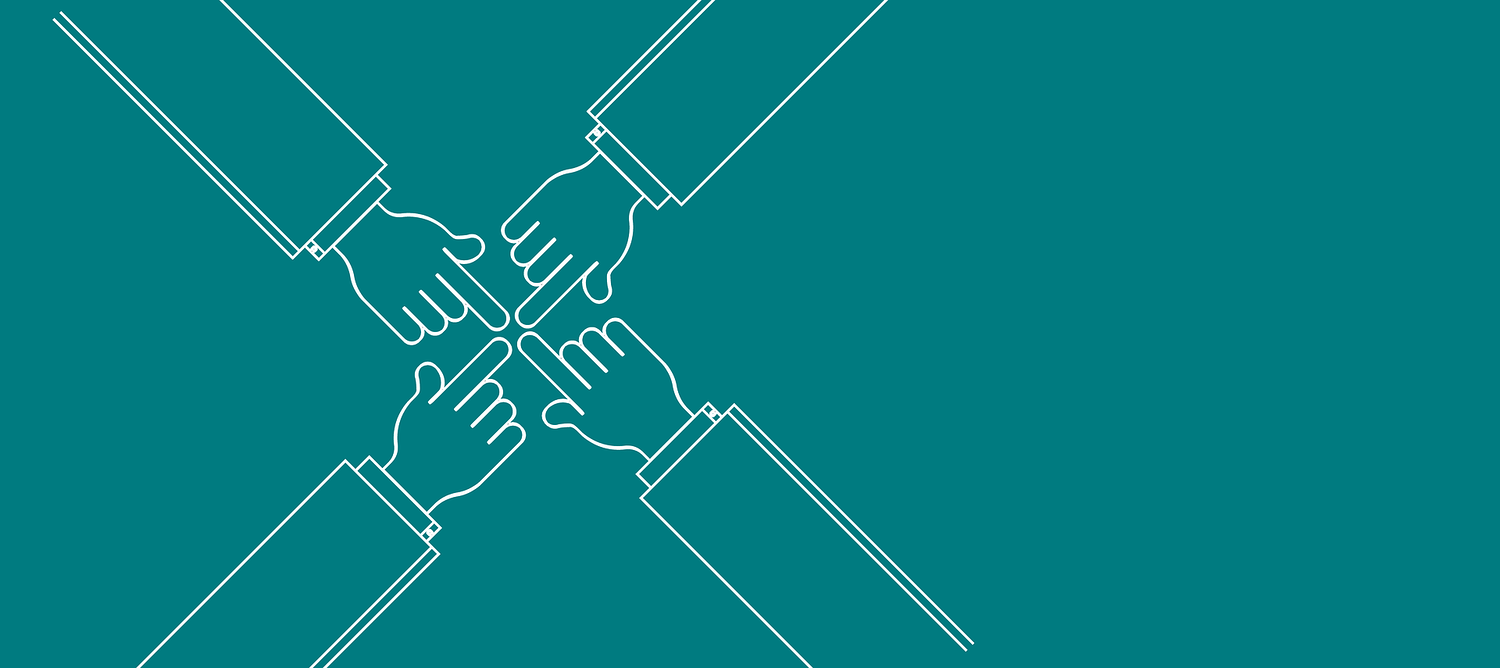Thema Gesellschaft
Der KLRÖ appelliert eindringlich an die Bundesregierung, unverzüglich einen breiten und tiefen Diskurs zur Frage "Arbeitsmarkt, Existenzsicherung und Menschenrecht auf sinnstiftende Entfaltungsmöglichkeit durch Teilhabe" in Angriff zu nehmen.